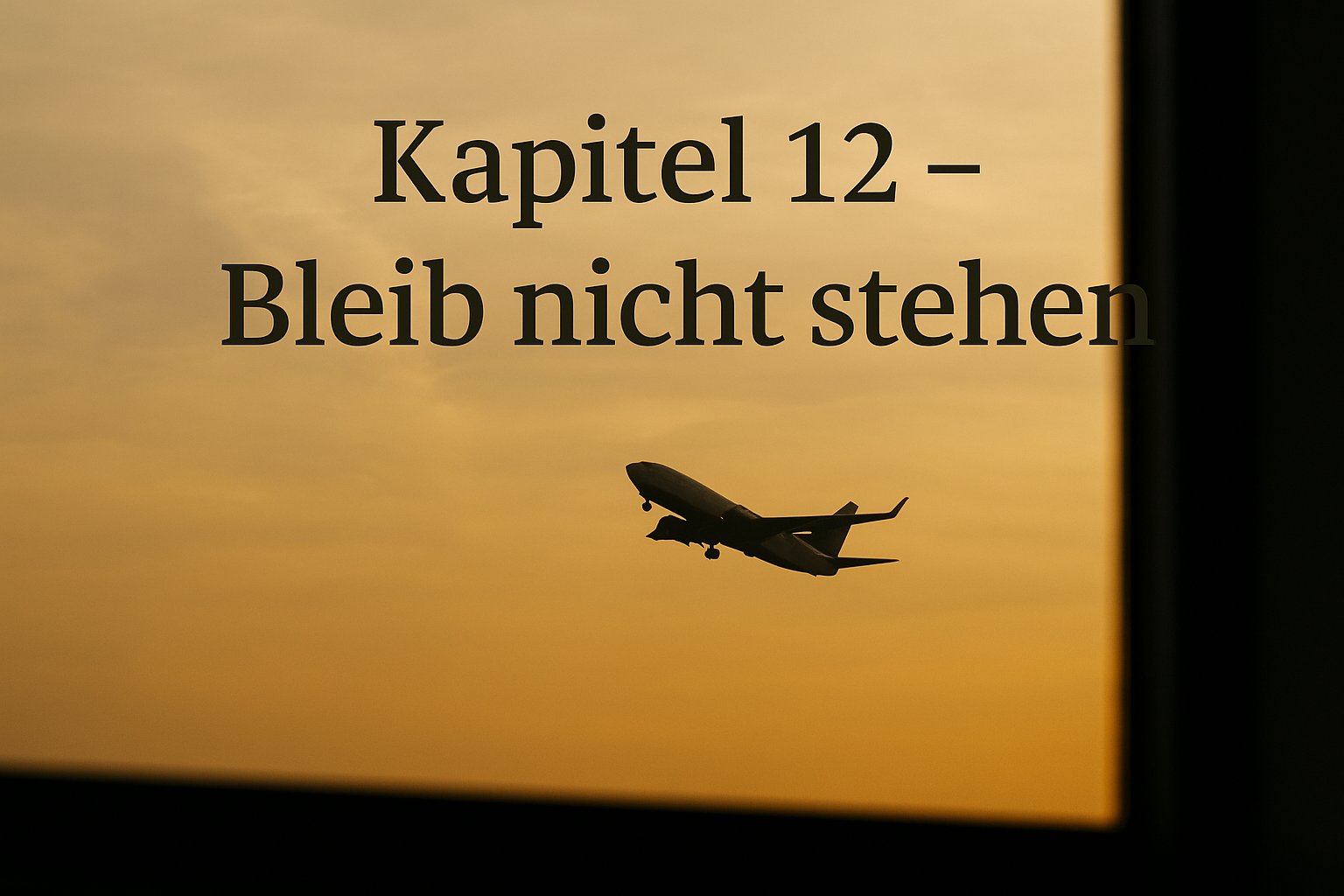Kapitel 15 – Ein Platz, der nicht mehr leer ist
Vorspann:
Oviedo im Licht eines stillen Vormittags.
Alte Balkone, flatternde Tücher, das Echo früherer Schritte.
Isabella und Sergio schweigen mehr, als sie sprechen –
und doch rückt etwas näher, das lange fern war:
ein Gefühl von Vertrautheit,
ein Schatten von Erinnerung,
ein Platz, der nicht mehr leer ist.
Zurück zu Kapitel 14 – Zögernde Schritte
Pflastersteine und erste Worte
Die Altstadt von Oviedo wirkte wie aus einem anderen Jahrhundert. Kopfsteinpflaster, das bei jedem Schritt unter Isabellas Schuhen leise klackte, Häuser mit schmiedeeisernen Balkonen, an denen bunte Wäsche flatterte. Die Straßen waren eng, aber voller Leben: Alte Männer spielten Domino vor Cafés, ein Straßenmusiker zupfte eine melancholische Melodie auf seiner Gitarre, irgendwo roch es nach gerösteten Maronen.
Sergio ging neben ihr, in entspanntem Tempo. Immer wieder zeigte er auf etwas – eine geschnitzte Tür, eine winzige Bäckerei mit seit Generationen unverändertem Schaufenster – und erzählte kleine Anekdoten. Mal auf Englisch, mal auf Spanisch, während Isabella versuchte, die Bruchstücke zu verstehen. Sie fragte nach, manchmal nur mit einem Blick, einem Stirnrunzeln – und er wiederholte geduldig, mit Händen, mit Lächeln.
„Diese Straße hier“, sagte er und zeigte auf eine besonders verwinkelte Gasse, „ist wie mein Gedächtnis. Ungeordnet, manchmal verloren, aber voller Geschichten.“
Isabella schwieg. Nicht, weil ihr nichts einfiel, sondern weil sie das Gefühl hatte, er meinte damit mehr als nur die Straße.
„Hast du schon Orte gefunden, die dich… erinnern?“ fragte sie vorsichtig.
Er zuckte mit den Schultern. „Ein paar. Oder vielleicht bilde ich es mir ein. Manchmal weiß man nicht, ob man etwas erkennt – oder ob man es sich nur wünscht.“
Sie nickte. Diese Art von Suche war ihr nicht fremd, nur hatte sie sie lange ignoriert.
Einige Minuten gingen sie schweigend weiter. Dann fragte er: „Und du? Wie ist deine Stadt?“
Isabella schnaubte leise. „Grau. Flach. Und die Menschen schauen selten nach oben.“
Sergio lachte. „Dann passt du nicht dorthin. Du schaust oft nach oben.“
Sie errötete, überrascht, dass er das bemerkt hatte.
Als sie später vor einer kleinen Kapelle standen und Sergio ihr erklärte, dass sie aus dem 9. Jahrhundert stammte, berührte Isabella zum ersten Mal eine der rauen Steinmauern. Sie schloss kurz die Augen, fühlte die Kühle unter ihren Fingern, die Geschichte. Neben ihr schwieg Sergio, und sie hatte das Gefühl, dass er genau verstand, was sie in diesem Moment suchte.
Es war kein spektakulärer Spaziergang. Keine großen Offenbarungen. Aber es war ein Anfang – auf alten Wegen, mit vorsichtigen Worten, getragen von einer Stille, die kein Unbehagen bedeutete.
Geschichten in der Nachmittagssonne
Sie saßen auf einer kleinen Steinmauer oberhalb der Altstadt, mit Blick auf die hügelige Landschaft Asturiens. Die Nachmittagssonne lag warm auf den roten Dächern, während unten in der Ferne die Glocken der Kathedrale läuteten. Es war ruhig. Nur ab und zu wehte eine Brise herüber und spielte mit einer Haarsträhne in Isabellas Gesicht. Sergio beobachtete sie kurz, sagte aber nichts.
„Ich habe lange gedacht, dass mein Leben so bleiben muss, wie es ist“, begann sie schließlich, leise. „Gelsenkirchen, Bürojob, allein. Kein Drama. Kein Aufbruch. Einfach… durchhalten.“
Sergio antwortete nicht sofort. Stattdessen reichte er ihr eine Feige, die er auf dem Markt gekauft hatte. Sie nahm sie, biss hinein. Sie schmeckte süß, weich, überraschend.
„Und warum nicht mehr?“ fragte er dann.
„Weil niemand mir je gesagt hat, dass mehr möglich ist. Oder dass ich es darf.“
Sie schaute auf ihre Hände. „Bis ich deinen Blog gelesen habe.“
Er sah sie an, ernst. „Das war nie meine Absicht. Ich wollte nur… verstehen, woher ich komme.“
Sie nickte. „Aber genau das hat mich berührt. Du bist auf der Suche. Nicht nur nach einem Ort, sondern nach einer Geschichte. Nach einer Wahrheit.“
Sergio lächelte flüchtig. „Mein Urgroßvater ist 1947 verschwunden. Einfach nicht mehr zurückgekehrt. Niemand sprach darüber. Aber ich habe als Kind gespürt, dass da etwas Ungesagtes war. Etwas, das fehlt. Und irgendwie glaube ich, dass der Wald damals in Galicien… dass er mehr wusste als ich.“
Isabella sah ihn erstaunt an.
„Der Wald?“
„Ja“, sagte Sergio. „Er war neblig, still. Aber ich hatte das Gefühl, dass ich nicht allein war. Als wäre mein Uropa da. Nicht sichtbar, aber irgendwie… fühlbar.“
Eine Weile schwiegen sie. Nur das entfernte Kreischen einer Möwe war zu hören.
„Ich habe niemanden verloren“, sagte Isabella dann. „Aber ich habe mich selbst irgendwann verlegt. Zwischen Excel-Tabellen, SAP und Kaffeetassen.“
„Und jetzt?“
Sie sah ihn an.
„Jetzt versuche ich, mich wiederzufinden. Vielleicht auf demselben Weg, den du gehst. Oder einem ganz anderen.“
Sergio nickte langsam. „Vielleicht treffen sich Wege manchmal. Für einen Moment. Und das reicht.“
Sie spürte, wie sich etwas in ihr verschob – eine Art innerer Platz, der bisher leer gewesen war. Nicht vollständig gefüllt, aber nicht mehr leer. Sie blickte in den Himmel. Keine Gewissheit. Aber ein Anfang.
Abspann:
Manchmal verändert sich nichts –
und doch ist danach alles anders.
Ein Gespräch, ein Blick, ein geteiltes Schweigen.
Die Stadt bleibt dieselbe.
Aber der Platz in uns beginnt, sich zu füllen.
Hat Dich dieses Kapitel berührt, irritiert oder neugierig gemacht?
Dann teile Deine Gedanken gern in den Kommentaren. Wenn Du anderen davon erzählen möchtest, hilfst Du Encina Alta dabei, sich weiter zu entfalten – durch ein Like, einen Repost oder einen Hinweis an Freund:innen.
Neue Kapitel erscheinen jeden Sonntag.
Folge dem Weg – Schritt für Schritt, Wort für Wort.
Zur Übersicht aller Kapitel →