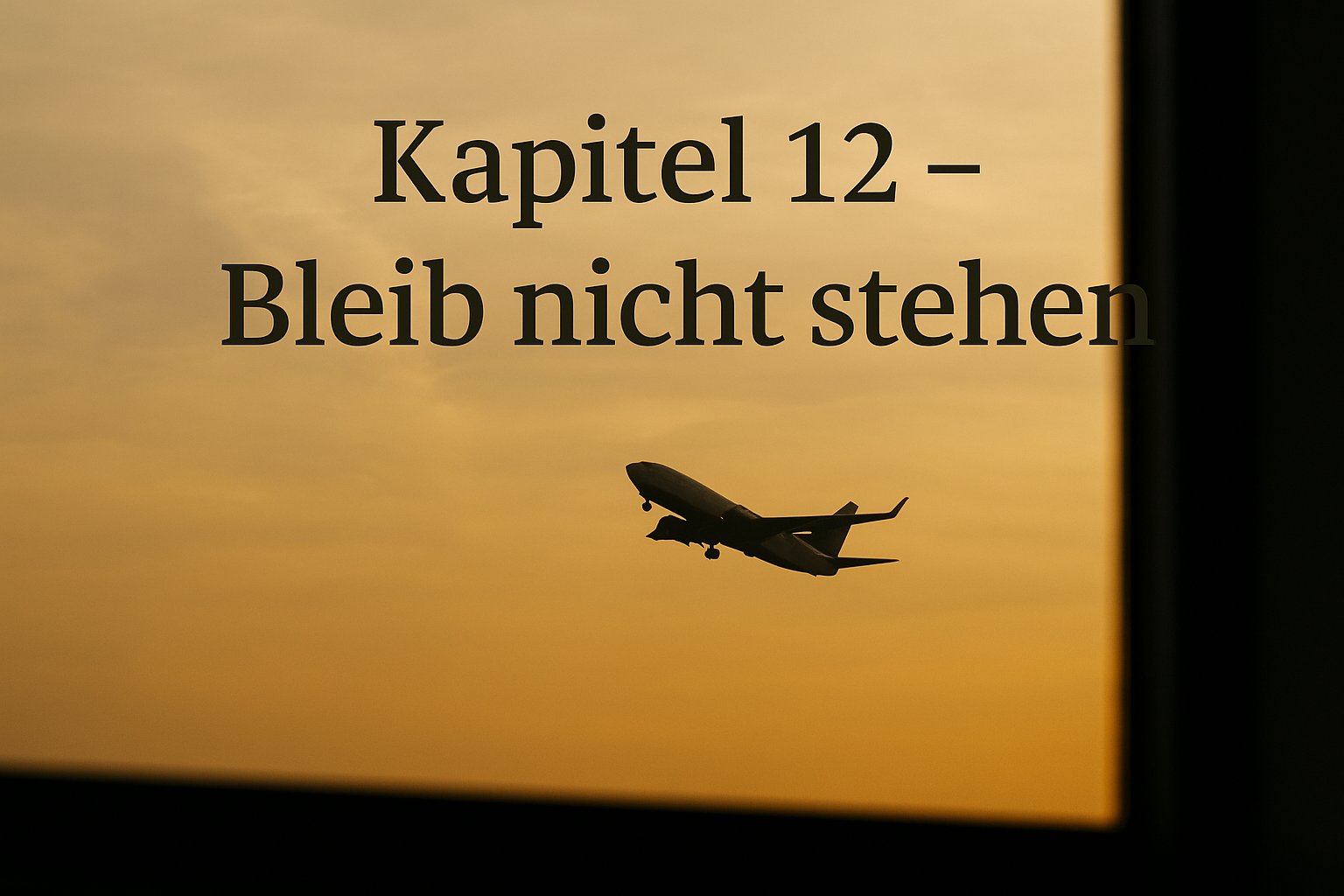Vorspann:
Ein verregneter Nachmittag führt Isabella und Sergio tiefer hinein in die Geschichte seiner Familie. Alte Dokumente und vergilbte Fotos öffnen Türen zu Geheimnissen, die seit Generationen verborgen liegen – und gleichzeitig wächst eine Nähe zwischen den beiden, die niemand vorausgeahnt hätte.
Hier geht es zurück zu Kapitel 16 – Stein und Stille!
Auf den Spuren der Vergangenheit
Es war ein regnerischer Nachmittag, als Sergio sie bat, ihm bei etwas zu helfen, das er schon lange vor sich herschob. Sie saßen in seinem kleinen Arbeitszimmer, das mehr nach einem chaotischen Archiv als einem Büro aussah. Überall lagen alte Papiere, Bücher, und Karten. Der Geruch von Staub und altem Papier hing in der Luft, während draußen der Regen gegen das Fenster trommelte.
„Es geht um meinen Urgroßvater“, begann er, während er eine vergilbte Fotografie aus einer Box holte. Es zeigte einen jungen Mann in einem Anzug, schmal und ernst, mit einem langen, dunklen Bart. „Er verschwand 1947, während des Bürgerkriegs. Niemand weiß, was mit ihm passiert ist.“
Isabella nahm das Bild in die Hand und betrachtete es aufmerksam. „Warum weiß niemand, was passiert ist?“
„Er war in der Armee der Republik, aber seine Einheit wurde aufgelöst, als Franco die Macht übernahm. Danach gibt es keine Aufzeichnungen mehr. Er wurde nie gefunden. Niemand hat ihm nachgetrauert, niemand hat nach ihm gesucht.“ Seine Stimme wurde leiser, als er das letzte Wort sprach.
Isabella sah ihn an und spürte die Schwere seiner Worte. „Das ist… tragisch.“
„Ja“, sagte er und ließ sich auf den Stuhl sinken. „Aber es ist mehr als das. Es ist, als würde ein Teil der Geschichte meiner Familie fehlen, als könnte ich nicht wirklich verstehen, wer ich bin, wenn ich nicht weiß, was mit ihm passiert ist.“
Er schaute sie an, die Augen voller Hoffnung. „Ich habe einige Aufzeichnungen, alte Briefe, militärische Dokumente, aber ich komme nicht weiter. Vielleicht… vielleicht kannst du mir helfen?“
Isabella nickte, ohne zu zögern. „Klar. Wie genau kann ich dir helfen?“
Er holte eine Sammlung von Papieren hervor und breitete sie vor ihr aus. „Ich habe einige alte Adressbücher, die er damals benutzt haben muss, und es gibt ein paar Einträge über seinen Verbleib in einem Archiv in Barcelona. Aber ich komme nicht weiter und ich weiß nicht, wo ich anfangen soll.“
„Lass uns das Schritt für Schritt durchgehen“, schlug Isabella vor. Sie hatte nie Interesse an Ahnenforschung gehabt, aber die Idee, etwas so Persönliches und Wichtiges für Sergio herauszufinden, berührte sie tief.
Sie verbrachten den Rest des Nachmittags damit, die alten Dokumente zu sortieren. Sergio half ihr, die spanischen Worte zu verstehen, und sie suchten online nach weiteren Hinweisen. Bei jeder neuen Entdeckung wuchs die Verbindung zwischen ihnen. Die Arbeit an diesem persönlichen Rätsel brachte sie näher zusammen, als Worte es je hätten tun können.
„Was, wenn wir nie herausfinden, was passiert ist?“, fragte sie leise, als sie ein weiteres, hoffnungsloses Archivdokument betrachteten.
„Dann bleibt die Geschichte für immer ein Teil von uns, auch wenn wir die Antworten nicht finden“, antwortete er, ohne sie anzusehen. „Aber ich kann nicht aufhören zu suchen.“
Isabella spürte eine unerklärliche Nähe, als sie über seine Schulter schaute, während er durch die nächsten Seiten blätterte. Sie wusste nicht, ob sie mehr für das Geheimnis seiner Familie empfand oder für Sergio selbst. Es war ein Gefühl, das sie nicht in Worte fassen konnte, aber es war da, zwischen ihnen, spürbar und ungesagt.
„Ich werde dir helfen, Sergio“, sagte sie schließlich und berührte leicht seine Hand. „Egal, wie lange es dauert.“
Er sah sie an, seine Augen weich und dankbar. „Danke. Du weißt gar nicht, wie viel mir das bedeutet.“
In diesem Moment war es nicht nur die Recherche, die sie zusammenbrachte. Es war das Gefühl, gemeinsam auf etwas Größeres hinzuarbeiten. Etwas, das sie beide verband – nicht nur durch die Geschichte, sondern durch ihre gemeinsame Reise in die Vergangenheit.
Ein gemeinsamer Moment
Es war ein Abend, an dem der Regen nachgelassen hatte, und die Luft draußen war frisch und kühl. Isabella und Sergio hatten sich dazu entschieden, nicht mehr weiter in den Dokumenten zu blättern. Stattdessen hatten sie ein kleines, gemütliches Restaurant in der Nähe ausgewählt, das für seine Tapas bekannt war – eine kleine, aber feine Oase im Herzen der Altstadt.
Sie saßen an einem runden Tisch in der Ecke, das Licht war gedämpft, und die Atmosphäre war entspannt. Isabella hatte das Gefühl, dass der Tag anstrengend gewesen war, aber auf eine gute Weise. Es war eine der ersten Nächte, in denen sie sich wirklich in Spanien angekommen fühlte. Nicht nur in einem neuen Land, sondern auch in einer neuen Lebensphase.
„Ich weiß nicht, ob du es je erwähnen hast, aber was isst du eigentlich am liebsten?“, fragte Isabella, als sie das Menü studierte.
Sergio sah auf, ein kleines Lächeln auf den Lippen. „Du wirst lachen, aber… Paella. Einfach. Nichts dabei.“
„Das ist nicht einfach“, sagte Isabella lachend. „Das ist ein Klassiker!“
„Ja, aber für mich ist es auch irgendwie… Erinnerungen. Als Kind, bei meinen Großeltern. Alles, was mit Paella zu tun hat, hat immer ein Stück meiner Kindheit. Du weißt, der Duft, der durch das Haus zieht. Aber eigentlich…“, er zögerte einen Moment, „eigentlich mag ich auch die einfachen Dinge: Brot, Oliven, Käse. Es muss nicht viel sein.“
Isabella nickte nachdenklich. „Ich verstehe. Ich habe nie viel Wert auf diese kleinen, aber besonderen Dinge gelegt. Vielleicht… habe ich sie nie richtig zu schätzen gewusst.“
Sergio sah sie aufmerksam an, als er das hörte. „Manchmal muss man erst weit weggehen, um das zu verstehen“, sagte er leise.
Kurz darauf brachte der Kellner die ersten Tapas. „Probier mal diese Albóndigas“, sagte Sergio, als er ihr einen kleinen Teller mit Fleischbällchen hinstellte. „Die sind unglaublich.“
Isabella nahm eine und probierte vorsichtig. „Mmmh… du hast recht. Die sind gut.“
Während sie aßen, redeten sie nicht nur über die Reise, sondern auch über alltägliche Dinge. Isabella erzählte von ihren Kollegen, die immer in Hektik lebten und nie wirklich Zeit für sich selbst fanden. Sergio lachte und erzählte von den eigenwilligen Charakteren in seiner Familie, von seinem Onkel, der stets darauf bestand, dass der „alte Weg“ der einzig wahre war, und seiner Tante, die immer mit einem Lächeln davon sprach, „die ganze Welt zu erobern“.
Das Gespräch fließend, begleitet von Lachen, das die Tischdecke füllte. Zwischen den Gängen fühlte sich die Atmosphäre locker an, beinahe so, als ob sie sich schon Jahre lang kannten.
„Es ist schon verrückt“, sagte Isabella nach einer Pause. „Ich habe das Gefühl, als würde ich mich in einem völlig anderen Leben wiederfinden. Als würde ich die letzten Jahre in Deutschland wie durch einen Nebel sehen. Wie ein anderer Mensch.“
Sergio nickte. „Manchmal braucht es einen Ort wie diesen, um wirklich zu verstehen, wer man ist. Oder wer man sein könnte.“
Sie spürte, dass in seinen Worten mehr lag als nur ein oberflächlicher Austausch. Etwas Unausgesprochenes, das sie beide in diesem Moment teilten. Eine Reise, die über das Entdecken von Orten hinausging. Es war eine Reise zu sich selbst, und sie waren einander dabei nicht mehr ganz so fremd.
„Ich glaube, ich habe nicht gewusst, wie viel ich vermisst habe“, sagte sie schließlich. „Wie wenig ich wirklich für mich selbst lebe.“
Sergio sah sie an, und sein Blick war warm, fast fürsorglich. „Es ist nicht zu spät, Isabella. Wir können immer noch lernen, was es bedeutet, wirklich zu leben.“
Sie hielt für einen Moment inne, dann nickte sie leise, als ob sie den stillen, aber mächtigen Hinweis in seinen Worten begriff. Etwas in ihr schwang mit, als ob sie gerade den ersten Schritt auf einem neuen Weg getan hatte. Die vertrauliche Nähe zwischen ihnen war gewachsen, nicht durch große Gesten oder Worte, sondern durch das stille Verständnis, das sich in diesem Moment zwischen ihnen aufbaute.
Der Abend neigte sich dem Ende zu, und als sie aus dem Restaurant traten, war die Nacht noch jung. Der Himmel war klar, und die Straßen von der feuchten Abendluft glitzernd. Isabella zog die Jacke enger um sich und ging neben Sergio, als sie den sanften Klang ihrer Schritte auf dem Kopfsteinpflaster hörte.
„Ich bin froh, dass wir heute Abend hier sind“, sagte sie, als sie ihn anblickte.
„Ich auch“, sagte er leise. „Vielleicht sind wir hier genau zur richtigen Zeit.“
In diesem Moment, bei dem stillen Erlöschen der Lichter der Stadt, fühlte sich alles richtig an. Es war nicht nur das Essen, nicht nur die Gespräche – es war der Moment, der sie beide verband. Die erste echte Vertrautheit.
Abspann:
Zwischen Archivrecherche und Tapas-Abend entsteht mehr als nur ein gemeinsames Projekt. Isabella und Sergio spüren, dass sie nicht nur nach Antworten in der Vergangenheit suchen – sondern auch nach ihrem Platz im Hier und Jetzt.
Hat Dich dieses Kapitel berührt, irritiert oder neugierig gemacht?
Dann teile Deine Gedanken gern in den Kommentaren. Wenn Du anderen davon erzählen möchtest, hilfst Du Encina Alta dabei, sich weiter zu entfalten – durch ein Like, einen Repost oder einen Hinweis an Freund:innen.
Neue Kapitel erscheinen jeden Sonntag.
Folge dem Weg – Schritt für Schritt, Wort für Wort.
Zur Übersicht aller Kapitel →